Beim Astrafilm-Festival gab es Dokumentarfilme aus aller Welt zu sehen
Ausgabe Nr. 2934

Festivalsdirektor Dumitru Budrala (vorne, am Mikrofon) präsentiert zum Abschluss der Preisgala, die am Samstag im Thaliasaal stattgefunden hat, sein 19-köpfiges Team, zu dem auch seine Gattin Csilla Kató (rechts außen) gehört. Foto: AFF
Eine Woche fühlte sich an wie ein Jahr auf Weltreise. Beim Astrafilm-Festival konnte man dieses Jahr von Kabul nach Chongqing oder von Hanau nach Novosibirsk reisen und das aus dem gemütlichen Kinosessel. Tragische Schicksale, fremde Kulturen, exotische Orte, all dies und mehr war beim 32. Dokumentarfestival Astrafilm zu sehen, das vom 17. bis 26. Oktober in Hermannstadt stattgefunden hat. Eine Auswahl von 70 Filmen aus allen Ecken der Erde begeisterte die Dokumentarfilmfans bei der diesjährigen Ausgabe des Astrafilm-Festivals, zusammengestellt von einem Team unter der Leitung von Dumitru Budrala und Csilla Kató.
Als erstes ging es nach Dänemark, in dem Eröffnungsfilm „Hacking Hate“ von Simon Klose. Die schwedische Journalistin My Vingren ermittelt undercover im Internet, um ein Netzwerk von Neonazis und rechtsextremen Organisationen aufzudecken, die weltweit Hassrede und Extremismus schüren. Die Journalistin zeigt dabei, wie leicht es ist, in Extremisten-Gruppen aufgenommen zu werden, aber auch wie schwer es ist herauszufinden, wer eigentlich hinter den ganzen Gruppierungen steht. Ihre „Reise” beginnt, indem sie einem „Golden One” (der Goldene) genannten lokalen YouTuber mit einer beachtlichen Fangemeinde folgt, wie er Gewichte stemmt, Proteinshakes trinkt und Joseph Goebbels als Vorbild hat. Es bleibt nicht dabei, denn Vingren steigt immer tiefer in den Kaninchenbau ab und entdeckt nordische Extremistengruppen mit Verbindungen zu realer Gewalt, Hassverbrechen, zu der Wagner-Söldnertruppe und zu Moskau, aber auch die Interesselosigkeit der Milliardenkonzerne wie YouTube und Twitter, die Nutzer zu kontrollieren, die zu ihren Profiten beitragen. Mit einer Frage gingen die Zuschauer raus und zwar: Wenn eine einzige Journalistin so viel erfahren
konnte, wer hat die rumänischen Geheimdienste davon abgehalten, den Wahlskandal vor wenigen Monaten zu entlarven und rechtzeitig die Protagonisten einzufangen?
Die Zuschauer reisten am Samstag nach Karabasch, eine arme Bergbaustadt nahe dem Uralgebirge. In dem Film „Mr. Nobody Against Putin“ wird ein Lehrer und Videograf zum Dokumentaristen russischer Indoktrinierung in der Schule, in der er arbeitet. Als Putins Regime Anfang 2022 die Ukraine angreift, ändern sich das Klima in der Schule und auch der Lehrplan schlagartig: Plötzlich müssen die Lehrer Propagandaunterricht abhalten, der Putins verzerrte Wahrnehmung der russischen Vergangenheit und Gegenwart in die Köpfe der Kinder und Jugendlichen trichtern soll. Den Unterricht muss Pasha filmen und nach Moskau als Beweis schicken, damit das Regime überprüfen kann, ob die Schüler auch die gewünschten Inhalte vermittelt bekommen. Morgendliche Fahnenaufmärsche, das gemeinsame Singen von Kriegsliedern und Besuche von Wagner-Söldnern, die den Schülern Handgranaten und Gewehre in die Hand drücken, ersetzen zunehmend den regulären Unterricht. Die Kriegsrealität hat voll und ganz von der Schule und ganz Karabasch Besitz ergriffen. Pasha beschließt einen mutigen Film für das demokratische Ausland zu filmen, um die schockierenden Vorkommnisse an der Schule und die russische Kriegswirklichkeit zu zeigen. Er entlarvt Putins Lügen, die Propaganda des Regimes und illustriert, wie Kinder und Jugendliche zum Werkzeug einer Diktatur gemacht werden.
Am Sonntag wurde am Rande des Films „Anatomia unor delicte obișnuite“ (Die Anatomie einer banaler Verbrechen) diskutiert, wo Femizid beginnt. An der Gesprächsrunde nahmen die Journalistinnen Paula Herlo und Ramona Ursu, sowie Eniko Gall von dem Verein A.L.E.G. und die Sängerin Erika Isac teil. Der Film zeigte den Kampf von vier Frauen, denen digitale Gewalt und sexueller Missbrauch von ihren Ex-Partnern widerfahren ist, mit der rumänischen Justiz. Der rumänische Film von Adina Sădeanu fängt sowohl den inneren Kampf als auch den Kampf um Gerechtigkeit in einer Welt ein, die blind ist für die tiefgreifenden psychologischen Schäden, die Cybermobbing einem Menschen zufügt. Familie, Freunde und Behörden erkennen die unsichtbaren Wunden nicht und dass die Offenlegung der eigenen Intimität im Internet einer körperlichen sexuellen Aggression gleichkommt.
Am Montag reisten die Zuschauer nach Utah, wo der Dokustreifen „God’s Other Plan“ von Moritz Müller-Preißer gedreht wurde. Der Film erzählt von einer Patchwork-Familie mit mormonischen Wurzeln und wie ihr Leben jetzt aussieht, nachdem sie die Glaubensgemeinschaft hinter sich gelassen haben. Vor rund 18 Jahren war der Dokumentarfilmer als Austauschschüler in Utah bei Rileys Familie zu Gast, wo er den mormonischen Glauben und dessen Traditionen kennenlernte.
Als er dann erfuhr, dass Riley sich überraschend als schwul geoutet hatte, war sein Interesse groß, wie das mit seiner religiösen Herkunft zusammenpasst. Dafür besuchten er und sein Kameramann Jacob Sauermilch über ein Jahr lang mehrmals die Familie und hielten ihren Alltag aus einer beobachtenden Perspektive fest. Riley wuchs mit sechs Geschwistern auf, heiratete seine gute Freundin Jenna und sie bekamen zusammen eine Tochter. Doch dann entschied er sich, diesen Weg zu verlassen und hatte sein überraschendes Coming-out. Er ist nun mit Brock zusammen und gemeinsam haben sie einen Sohn (ebenfalls von Jenna) adoptiert. Die fünf sind eine Patchwork-Familie im besten Sinne des Wortes, die aber von der streng religiösen Verwandtschaft nicht akzeptiert wird.
Nach Nowosibirsk reisten die Dokumentarfilmfans am Mittwoch, als der Film „Happiness To All“ von Filip Remunda gezeigt wurde. Der Film ist eine soziologische Untersuchung der russischen Gesellschaft vor und nach dem Einmarsch in die Ukraine. Der Dokumentarfilm bietet einen Einblick in die wachsenden generations- und ideologischen Unterschiede im postsowjetischen Russland, wo ältere Generationen an der Stabilität der Vergangenheit festhalten, während junge Menschen radikalisierte Ansichten vertreten, um ihrer Frustration Ausdruck zu verleihen. Vitalys Reise verkörpert diese Kluft, seine Enttäuschung steht symbolisch für einen Mann, der von einer Gesellschaft zurückgelassen wurde, mit der er sich einst identifizierte.
Eine nicht „weltbewegende” Geschichte, sondern eine eher einfache, die man im Alltag antreffen kann, war „Optimizing Everything” (Alles optimiert, Regie Florian Karner). Charly, der 60-jährige Familienvater und Unternehmensberater, hat sich entschieden, aus Karl-Heinz geborener Franke eine optimierte Persönlichkeit zu schaffen – daher auch der neue Name, Charly. Dabei will er nie wieder verletzlich sein und lebt seinen „gesunden Egoismus” aus – was allerdings Kinder und Partnerin weniger erfreut.
Hanau in Hessen war am 19. Februar 2020 der Tatort eines grausamen rassistischen Attentats. In dem Film „Das deutsche Volk“, der am Donnerstag gezeigt wurde, begleitet Marcin Wierzhowski Überlebende und Hinterbliebene des Anschlags, bei dem neun junge Menschen, darunter ein Roma aus Rumänien, getötet wurden. Die Überlebenden kämpfen nicht nur für die Ermordeten, sondern auch um Wahrheit und Gerechtigkeit. Vier Jahre lang begleitet Regisseur Marcin Wierzchowski ihren unermüdlichen Widerstand gegen das Vergessen – und stellt die aktuell wieder drängende Frage: Wer gehört zu Deutschland und wer nicht? Nach dem Doku war Niculescu Păun – der Vater eines der Opfer und der einzige Rumäne unter ihnen – auf der Bühne und beantwortete die Fragen des Publikums. Trotz der Tragödie, die er und seine Frau durchgemacht haben, sind sie in Deutschland geblieben.

Die tschechische prämierte Journalistin Ivana Svobodová („Pit Stop Reporter”) berichtet in ihrem Heimatland von Anhängern von Verschwörungstheorien und als Zuschauer hat man das Gefühl, dass sie als Kriegsreporterin ein „einfacheres” Leben hatte.
„Pit Stop Reporter” (Regie Zora Čápová, Tschechien) war ein weiterer Film, der der Bedeutung der Presse gewidmet war: Ivana Svobodová arbeitet für die Zeitung „Respekt”, ist eine erfahrene, engagierte und preisgekrönte politische Journalistin, die während ihrer Recherchen auf eine Frage antworten muss, für sich und ihre Leserschaft: Welche Rolle spielen die Massenmedien in einer Welt, in der sich alles in sozialen Netzwerken abspielt und es so einfach ist, Leser in ihren abgeschotteten „Blasen“ zu manipulieren? Während sie über einen rechtsradikalen Politiker berichten will, trifft sie auf eine aggressive, gespaltene, korrupte und radikalisierte Gesellschaft, die von ihren Leadern manipuliert wird. Nicht nur, dass sie der Presse überhaupt nicht mehr trauen, sondern sie greifen sie sogar persönlich an. Ihre einzigen Minuten der Ruhe findet die Journalistin auf den Rückfahrten von den Rechercheorten, wo sie in Tankstellen bei Kaffee und Zigarette ihre Gedanken zu ordnen scheint.
Die Zuschauer flogen am Freitag nach China, in die Stadt Chongqing, zum vielleicht lustigsten Film des Festivals: „Dating Game”, Regie Violet Du Feng. Ausgangspunkt des Films ist eigentlich eine dramatische Begebenheit: Nach der Ein-Kind-Politik herrscht in China ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern und es gibt deutlich mehr Männer als Frauen. So wird es für Männer immer schwieriger, eine Partnerin zu finden. Drei junge Männer aus ländlichen Gebieten nehmen deswegen an einem siebentägigen Kurs unter der Leitung von Hao, einem Beziehungsexperten, teil. Dort lernen sie, wie man Frauen erobert. Die unpassenden und filmreifen Verführungstechniken und die Versuche, ihr Image und Online-Profil zu optimieren, ließen die Zuschauer immer wieder laut auflachen.
Am Samstag lernten die Hermannstädter die Taliban aus Kabul kennen. „Kabul, Between Prayers“ von Aboozar Amini spielt im heutigen Kabul in Afghanistan, wo der 23-jährige Samin lebt. Von der ersten Aufnahme an begleitet der Dokumentarfilm Samin, einen jungen Soldaten, der sich seit seiner Kindheit der Bewegung und Ideologie der Taliban verschrieben hat. Im Laufe des Films erlebt das Publikum seinen Konflikt zwischen seinem Alltag als Ehemann und Bauer und seiner militärischen Existenz, verbunden mit dem Wunsch und dem Versprechen des Märtyrertums. Gleichzeitig sehen wir seinen 14-jährigen jüngeren Bruder Rafi, der seine Kindheit hinter sich lässt, um in eine militärische und radikalisierte Welt einzutreten. „Kabul Between Prayers“ versucht, einen Einblick in das heutige Alltagsleben in Afghanistan zu geben, ohne dabei zu urteilen. Stattdessen wird der Dokumentarfilm lediglich von dem Wunsch getragen, seinen Protagonisten, einen Taliban-Soldaten, als Menschen kennenzulernen. Samin ist in dieser Erzählung nicht der Bösewicht, sondern einfach nur ein Mensch, der ebenso wie sein Bruder einer radikalen und gefährlichen Ideologie zum Opfer gefallen ist. Der Film hat den Preis „Bester Dokumentarfilm“ in der Kategorie „Emerging Voices” gewonnen.
Ein sehr trauriger Film beendete das diesjährige Astrafilm-Festival: „Portrait of a Confused Father“ ist ein 20-jähriges Filmprojekt des Filmemachers Gunnar Hall Jensen über seinen Sohn, den er seit seiner Kindheit bis zu seinem Tod gefilmt hat.
Gunnar, ein kontrollsüchtiger Macho-Vater, hat Schwierigkeiten, eine Bindung zu seinem freigeistigen Sohn Jonathan aufzubauen. Trotz seiner ungeschickten Versuche wächst ihre Verbindung, bis Jonathan mit 18 plötzlich verschwindet und in Brasilien wieder auftaucht, wo er sich in einen männlichen Influencer verliebt hat. Auf der Suche nach Reichtum gerät Jonathan unter den Druck der modernen Welt und lässt Gunnar zurück, um über Vaterschaft, Männlichkeit und ihre Beziehung nachzudenken. Erzählt durch Gunnars ehrliche Voice-over-Kommentare und 22 Jahre Familienaufnahmen, ist „Portrait of a Confused Father“ eine herzliche Auseinandersetzung mit Bindung, Loslösung und bedingungsloser Liebe, die Humor, Reflexion und untröstliche Trauer miteinander verbindet.
Das Astrafilm-Team hat auch dieses Jahr ein abwechslungsreiches Angebot an Dokus für Erwachsene vorbereitet, die man online bis zum 9. November auf https://online.astrafilm.ro/ sehen kann. Pro Film zahlt man 25 Lei, ein Abo für 150 und 34 Dokus ist aber zu empfehlen – so kommt auch die Vorfreude für das folgende Astrafilm-Festival auf, das voraussichtlich nach Mitte Oktober 2026 stattfindet.
Cynthia PINTER
Ruxandra STĂNESCU
Gewinner Astrafilm-Festival 2025
„Neue Generation der Filmemacher”: Bester Dokumentarfilm: „Kabul, în-
tre rugăciuni” (Kabul, zwischen den Gebeten, Regie Aboozar Amini, Niederlande, 2025); Beste Regie: „Spre Vest, în Zapata” (Gen Westen, in Zapata, Regie David Bim, Kuba, 2025);
Osteuropa: Bester Dokumentarfilm: „Dragul meu Théo“ (Meine lieber Théo, Regie Alisa Kovalenko, Ukraine, 2025).
Rumänien: Bester Dokumentarfilm: „Still Nia“ (Immer noch Nia, Regie Paula Oneț, Rumänien, 2025); Beste Regie: „Viitor luminos“ (Strahlende Zukunft, Regie Andra MacMasters, Rumänien, 2025);
DocSchool: Bester Dokumentarfilm: „Planul necunoscut al lui Dumnezeu“ (Gottes unbekannter Plan, Regie Moritz Müller-Preisser, Deutschland, 2025);
DocShorts: Bester Dokumentarfilm: „67 de milisecunde” (67 Millisekunden, Fleury Fontaine, Frankreich, 2025).
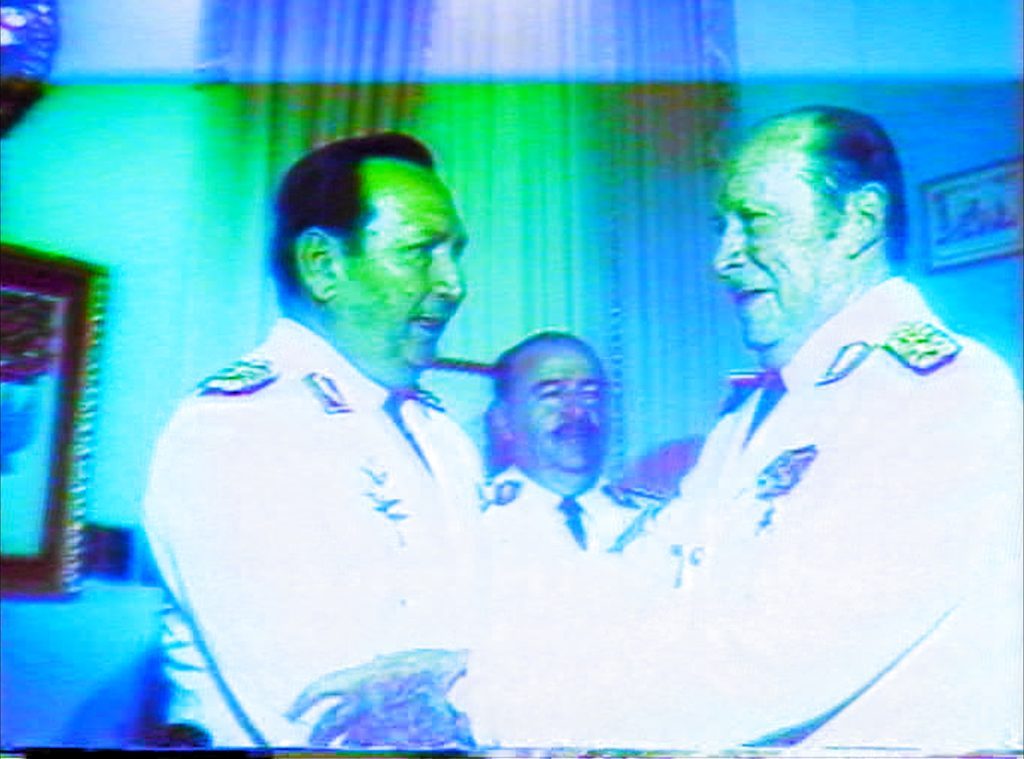
Bilder einer Diktatur: Der Dokumentarfilm „Under the Flags, the Sun“ (Bajo las banderas, el sol) von Juanjo Pereira ist eine eindringliche Aufarbeitung der Militärdiktatur von Alfredo Stroessner in Paraguay (1954–1989). Der Film thematisiert die Zerstörung von Zeitzeugnissen durch das Regime mit starken kulthaften Zügen, was die technische und visuelle Qualität des geretteten Archivmaterials erklärt – verwackelte Bilder und beschädigter Film dienen Pereira als stilistisches Mittel. Untermalt wird die visuelle Collage durch dissonante, unangenehme Musik, die das unterschwellige Unbehagen beim Zuschauer verstärkt. Die Diktatur, die von 1954 bis 1989 dauerte, wurde im Kalten Krieg von den USA unterstützt. Im Inneren herrschte brutale Repression: Das Justizsystem war kontrolliert, politische Gegner wurden ohne Gerichtsverfahren inhaftiert, gefoltert, teils mit nationalsozialistischen Methoden, und ermordet. Es wird geschätzt, dass mindestens 20.000 dokumentierte Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur passiert sind. Die Ära Stroessner endete 1989 durch einen Putsch von General Andrés Rodríguez. Stroessner musste sich nie vor Gericht verantworten. Der Film wird so zu einer fragmentarischen, aber tiefgreifenden Archäologie der Vergangenheit, deren Brüche in Paraguay bis heute nachwirken, da die Colorado-Partei auch nach dem Putsch ihre Macht weitgehend behielt.
Max GALTER/Katharina HENSEL
